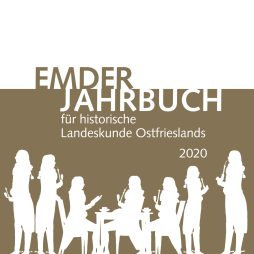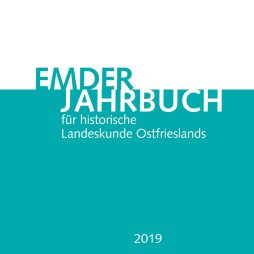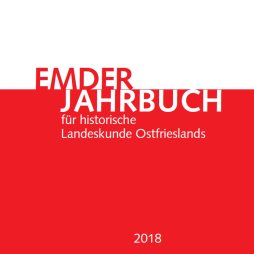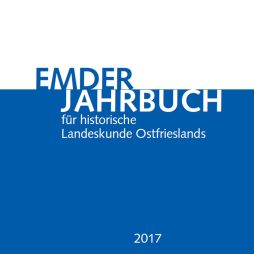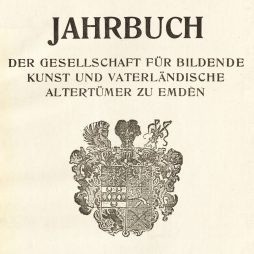-
Lengen, Hajo van: Die Entstehung der Burg Leerort. Ein Beitrag zu Burgenbau und Herrschaftsbildung während des 15. Jahrhunderts im südlichen Ostfriesland
Zusammenfassung
Die nach Beninga und Emmius in der älteren Literatur bis in die jüngste Vergangenheit wiederholte Überlieferung, dass die Burg Leerort von den Hamburgern während ihrer ersten Besatzungszeit (1433-39) erbaut worden sei, ist nicht zutreffend. Eine nähere Analyse der späteren Chronistik sowie zeitgenössischer Nachrichten und Urkunden ergibt, dass im Falle von Leerort zwei Befestigungsphasen zu unterscheiden sind: Während der ersten entstand hier lediglich eine Landwehr und wahrscheinlich von den Brüdern Edzard und Ulrich Cirksena als Anführer der gegen die Ukena vereinten ostfriesischen Landesgemeinden nach der 1431 erfolgten Zerstörung der Burg des Focko Ukena in Leer errichtet. Als die Hamburger von Emden aus von 1435 bis 1439 den Süden Ostfrieslands beherrschten, dürften die Cirksena ihnen den befestigten Leerort eingeräumt haben. Als die Hamburger 1439 aus Ostfriesland abzogen, übergaben sie den Cirksena ihre Herrschaft mit der Burg Emden zur Verwahrung. Als es nach ihrer Rückkehr 1447 bald zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen ihnen und Ulrich Cirksena kam, erfolgte um 1450 eine zweite Befestigung von Leerort, indem die Hamburger hier jetzt eine regelrechte Burg erbauten. Diese wurde dann, als sie 1453 abermals abzogen, Ulrich Cirksena mit der Burg Emden ebenfalls ausdrücklich zur Verwahrung übertragen. Da der Baugrund offenbar zum Ukenaschen Erbe seiner Frau gehörte, konnte er ihn als deren Eigenerbe betrachten, so dass er allein hinsichtlich der Gebäude in der Schuld der Hamburger stand. Der für Leerort später überlieferte „Hamburger Turm“ ist unter den in der Festung Leerort erhalten gebliebenen Türmen nicht nachzuweisen. Wenn es sich hierbei nicht um eine Legende handelt, sondern er eine Tatsache gewesen ist, dann war er jedenfalls in der frühen Neuzeit bereits verschwunden.
Vollständiger Aufsatz (PDF, 740,62 kB)
-
Lengen, Hajo van: Wann wurde die Rysumer Orgel gebaut?
Zusammenfassung
Die bisherige Datierung des Baues der Rysumer Orgel in das Jahr 1457 basiert auf einem von Eggerik Beninga (+ 1562) in seiner „Cronica der Fresen“ berichteten, an seinen Urgroßvater Olde Imel Allena-Beninga gesandten, nicht datierten Schreiben der Rysumer Kirchengemeinde, das er in seinem Hausarchiv vorgefunden hatte, und von dem er aufgrund der Fundsituation glaubte, dass es aus dem Jahr 1457 stammen müsste. Diese seine Zuordnung war falsch, weil vom Inhalt her das Schreiben zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn macht. Es gehörte vielmehr in einen ganz anderen Zeitraum, und zwar in einen Zusammenhang von kriegerischen Ereignissen, die 17 Jahre zuvor geschehen waren. Daraus ergibt sich für die Datierung der Rysumer Orgel, dass sie bereits um 1440 (zwischen 1439 und 1441) erbaut worden sein muss.
Vollständiger Aufsatz (PDF, 569,25 kB)
-
Holtkotten, Gerd: Der erste "ökumenische katholische Gesellenverein" im Bistum Osnabrück: Weener
Zusammenfassung
Katholiken in Ostfriesland waren und sind eine kleine Minderheit. Dennoch wurde im Jahre 1865 in Weener ein katholischer Gesellenverein gegründet, der sich auf die Ideen des katholischen Priesters und Sozialreformers Adolph Kolping berief. Impulsgeber und Motor war der Pfarrer der noch jungen katholischen St. Josephs-Gemeinde, Johann Wilhelm Burken. Im Vertrauen auf das respekt- und vertrauensvolle Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten vor Ort wagte er den Versuch, einen solchen katholischen Verein zu errichten, der auch für Nichtkatholiken offen war. Die positiven Erfahrungen in und mit dem Kölner Gesellenverein, den zwei evangelische Handwerksburschen aus dem Bereich Weener in den 1850er Jahren machen konnten, haben Burken in seinem Vorhaben bestärkt. Die Zeit war jedoch offensichtlich noch nicht reif für ein solches „ökumenisches Experiment“, wie die Auflösung des Vereins im Jahre 1871 zeigt. Nicht zuletzt haben hierbei auch die Bestrebungen in der katholischen Kirche, die besondere Bedeutung des Papstamtes im sog. Unfehlbarkeitsdogma herauszustellen, maßgeblich mitgewirkt.
Vollständiger Aufsatz (PDF, 516,47 kB)
-
Prahm, Heyo: Dr. med. Hermine Heusler-Edenhuizen - Neues zu ihrer ärztlichen und politischen Haltung
Zusammenfassung
In Ergänzung der erstmals 1996 veröffentlichten Lebenserinnerungen von Hermine Heusler-Edenhuizen (1872-1955) werden hier weitere Erkenntnisse zu ihrer ärztlichen und politischen Haltung vorgelegt. Die aus Pewsum bei Emden stammende erste deutsche Frauenärztin hatte sich von der höheren Tochter aus der preußischen Provinz Ostfriesland im Berlin der Weimarer Republik zu einer der bekanntesten Ärztinnen Deutschlands entwickelt. Ihrer Lehrerin Helene Lange widmete sie 1928 zum 80. Geburtstag eine Beschreibung des Lebens als höhere Tochter. Als Gründungsvorsitzende des Bundes Deutscher Ärztinnen (1924) war sie auch international bekannt geworden. Ihren Kampf gegen den § 218 StGB führte sie als moderne, wissenschaftlich denkende Frau. Ihr Ansehen führte auch zur Bestellung als Gutachterin in drei spektakulären Prozessen. 1925 und 1935 ging es um die Hilfe für Ärztinnen, die wegen angeblicher gewerbsmäßiger Abtreibungen inhaftiert waren und 1932 um die beabsichtigte Kürzung der Lehrerinnengehälter durch die Brüningschen Notverordnungen wegen angeblicher Minderleistungsfähigkeit von Frauen. Aus ihrer ärztlich-humanitären Haltung entwickelte sich auch ihre und ihres Mannes Otto Heusler Ablehnung des Nationalsozialismus, obwohl sie 1933 noch in einem Artikel das neue Sterilisierungsgesetz insbesondere bei Alkoholismus begrüßte und sich den möglichen Missbrauch nicht vorstellen konnte.
Vollständiger Aufsatz (PDF, 1,16 MB)
-
Hermann, Michael: Dr. Hero Tilemann - ein ostfriesischer Arzt im Burenkrieg 1899-1902
Zusammenfassung
Ende 1899 entschloss sich der 26-jährige Doktorand der Medizin und gebürtige Ostfriese, Hero Tilemann, sich einer freiwilligen Sanitätsexpedition nach Südafrika anzuschließen, um die Verwundeten und Kranken auf der Seite der Buren, die im Krieg gegen das britische Empire standen, medizinisch zu versorgen. Als einziger europäischer Arzt blieb er bis zum Friedensschluss 1902 in den Burenrepubliken Transvaal und Oranje-Freistaat. Seine Tagebuchaufzeichnungen, die posthum 1908 veröffentlicht wurden, geben einen subjektiven, aber auch unmittelbaren Einblick in das Kriegsgeschehen und lassen Rückschlüsse auf Tilemanns pro-burische und anti-britische Haltung zu. Tilemann, der die Gefahren und Strapazen des Krieges mit den Burenkommandos teilte, gab seine ärztlich bedingte Neutralität immer mehr auf, bis ihm das Schicksal der Buren immer mehr ans Herz gewachsen war. Zu dieser Veränderung trug auch das von ihm unmittelbar beobachtete Elend der Frauen und Kinder bei, die von den britischen Soldaten in die sogenannten „concentration camps“ verschleppt wurden. Während Tilemann selbst darauf achtete, die Artikel der Genfer Konvention im Burenkrieg vollständig zu erfüllen, beschuldigte er die Briten, mehrmals die internationale Vereinbarung verletzt zu haben. Nach der Rückkehr in die Heimat führte er den Krieg auf seine Art und Weise fort, indem er – allerdings vergeblich – Entschädigungsansprüche an die britische Regierung für die Verbrennung seiner Ambulanzwagen und die Plünderung der von Tilemann provisorisch errichteten Hospitäler stellte. Im Juni 1907 kam Tilemann bei einer Bootsfahrt auf der Elbe ums Leben.
Vollständiger Aufsatz (PDF, 443,25 kB)
-
Eggens, Albert: Schmuggel in den Nordostniederlanden während des Ersten Weltkriegs
Dieser Aufsatz kann aus rechtlichen Gründen nicht im Open Access angeboten werden.
-
Kappelhoff, Bernd: Von der übervollen Sammlungsschau zum Ostfriesischen Landesmuseum Emden als Volksbildungsstätte. Die Auseinandersetzungen um die konzeptionelle Neugestaltung des Museums der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden ab 1927/28 und der Kampf um ihre Gleichschaltung im NS-Staat - Teil 1
Zusammenfassung aller drei Teile
Der Aufsatz stellt die Geschichte des aus dem 19. Jahrhundert überkommenen Museums der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden und seines Wandels zu einer nach modernen museumspädagogischen Gesichtspunkten eingerichteten allgemeinen Bildungseinrichtung seit den späten 1920er Jahren dar und zeichnet seine weitere Entwicklung unter dem 1934 verliehenen neuen Titel „Ostfriesisches Landesmuseum“ bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs nach. Die Darstellung, die mit der Einordnung dieses Modernisierungsprozesses in die allgemeine Museumsreformbewegung in Deutschland seit dem Ende des Ersten Weltkriegs einsetzt und sich auf eine Vielzahl bislang völlig unbekannt gewesener Quellen stützen kann, ist für diesen Zeitraum zugleich eine in höchstmöglichem Maße authentische Geschichte der das Museum tragenden „Emder Kunst“ selbst, denn auch deren Wandlung von einer behäbigen bürgerlichen Honoratiorenvereinigung mit allerdings teilweise hohem geschichtswissenschaftlichen Anspruch zu einer gesellschaftlich breiter verwurzelten und näher an den Ansprüchen der Gegenwart ausgerichteten Institution wird bis in viele Verästelungen hinein beschrieben und analysiert.
Im ersten Teil steht der ab 1927/28 unternommene Versuch im Mittelpunkt, das Museum massiv zu entschlacken und zu einer modernen Volksbildungsstätte umzugestalten. Dieser Versuch scheiterte jedoch, weil der eigens zu diesem Zweck eingestellte Museumskonservator Jan Fastenau, die erste hauptamtlich tätige Fachkraft dieses Hauses überhaupt, den Anforderungen des musealen Alltags zu wenig genügte und deshalb mit dem Vorstand der „Kunst“ in einen tiefgreifenden Konflikt geriet, der jahrelang alle Ansätze zu einer zeitgemäßen Modernisierung des Museums wirkungslos bleiben ließ. Mit Fastenaus Entlassung im Sommer 1933 fand dieser Konflikt allerdings keineswegs ein Ende, vielmehr verschärfte sich – dies ist das Hauptthema des zweiten Teils – die Auseinandersetzung seitdem massiv, denn durch das Eingreifen des nationalsozialistischen Kampfbundes für deutsche Kultur, das von einigen der höchsten Kulturrepräsentanten der Provinzialverwaltung in Hannover heimlich veranlasst worden war und über Monate hin ebenso heimlich gesteuert wurde, ging es nunmehr um die Gleichschaltung des „Kunst“-Vorstands und um die Ausrichtung der „Kunst“ auf die Ziele des NS-Staates überhaupt. Zum Hauptakteur in diesem Kampf auf Seiten der „Kunst“ wurde der erst Anfang 1933 mit gerade 26 Jahren als Schatzmeister in deren Vorstand aufgestiegene Anton Kappelhoff, dessen zäher und phantasiereicher Einsatz den Elan der Angreifer ermüden ließ und schließlich im Frühjahr 1934 nach dem unvermeidlich gewordenen Rücktritt des bisherigen Vorstands dazu führte, dass er nach dem nunmehr geltenden Führerprinzip vom Auricher Regierungspräsidenten zum 1. Vorsitzenden der „Kunst“ berufen wurde.
Im dritten Teil geht es um die von Kappelhoff fortan über mehrere Jahre hin betriebene und inhaltlich von Alexander Dorner, dem Leiter der Kunstabteilung des Landesmuseums Hannover, maßgeblich unterstützte grundlegende Modernisierung und Erweiterung des Museums, durch die er es erreichte, dass das Emder Haus zu einem der besten Museen der Provinz Hannover wurde. Dessen damaliger, bislang nur ansatzweise bekannter Zustand wird hier erstmals systematisch rekonstruiert und mit Hilfe zahlreicher aussagekräftiger Fotos weitestgehend visualisiert. Kappelhoffs großer Einsatz für die „Kunst“ und ihr Museum wurde allerdings nicht belohnt, denn Ende 1937 geriet er infolge einer Intrige mit der örtlichen Leitung der NSDAP in Konflikt und musste sein Amt als 1. Vorsitzender der „Kunst“ abgeben. Das von ihm mit so großem Erfolg umgestaltete Museumsgebäude ist im Zweiten Weltkrieg zwar untergegangen, doch der größte Teil von dessen Beständen blieb erhalten und bildete später die Grundlage für den Wieder- bzw. Neuaufbau des Ostfriesischen Landesmuseums.
Teil 2 (Emder Jahrbuch 97.2017 – PDF, 818,05 kB)
Teil 3 (Emder Jahrbuch 98.2018 – PDF, 2,29 MB)Teil 1 (PDF, 417,86)
II. Miszellen
-
Ibbeken, Cornelia / Dirksen, Johann: Die Appellative "Deich", "Diek" und "Dyk" in der ostfriesischen Flurnamensammlung
Textanfang
Das Projekt Flurnamendeutung, dessen Träger die Ostfriesische Landschaft, das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung – Regionaldirektion Aurich – (LGLN) und das Niedersächsische Landesarchiv – Standort Aurich – sind, gibt es seit September 2009. Ziel des Projekts ist die Deutung der ca. 72.000 Flurnamen Ostfrieslands, die von einer Arbeitsgruppe der Ostfriesischen Landschaft um Heinrich Schumacher zusammengetragen und 2002 im Verlag der Ostfriesischen Landschaft in einem sechsbändigen Werk veröffentlicht wurden.
[…]Vollständiger Aufsatz (PDF, 775,28 kB)